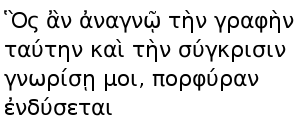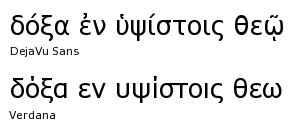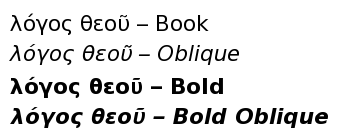»Nämlich die Worte müssen rein bleiben. Denn
Ein Schwert kann zerbrochen werden und ein Mann
Kann auch zerbrochen werden, aber die Worte
Fallen in das Getriebe der Welt uneinholbar
Kenntlich machend die Dinge oder unkenntlich.
Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche.
So stellten sie auf, nicht fürchtend die unreine Wahrheit
In Erwartung des Feinds ein vorläufiges Beispiel
Reinlicher Scheidung, nicht verbergend den Rest
Der nicht aufging im unaufhaltsamen Wandel«
Heiner Müller, Der Horatier (1968)
I.
Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center und den Pentagon von Dienstag, dem 11. September 2001, fragten viele Kommentatoren, was für ein Hass die Attentäter bewegt haben muss, um Verbrechen von solch einem (bis dahin unvorstellbaren) Ausmaß zu begehen. Aber ich denke, diese Frage vermittelt einen falschen Eindruck: als ob die Attentäter aus einem Gefühl heraus gehandelt hätten oder gar im Affekt. Denn nach allem, was wir über diese Verbrechen wissen, haben sie mit Gefühlen nur wenig zu tun.
Nicht nur, dass sie langfristig und höchst rational geplant worden sind, auch ihre Ziele waren nicht Personen, sondern Symbole einer Weltmacht. Dass dabei Menschen umkamen, war wahrscheinlich von vornherein nur im Hinblick auf den Effekt der großen Zahl von Bedeutung. Wenn man dem, was die Ermittlungsbehörden an die Öffentlichkeit dringen lassen, trauen darf, waren die Attentäter auch nicht geistig verwirrt oder psychisch labil, sondern Menschen, die ein unauffälliges Leben in Deutschland und den Vereinigten Staaten führten, ein naturwissenschaftliches Studium absolvierten bzw. abgeschlossen hatten und sich in aller Ruhe auf das Verbrechen vorbereiteten. Die Attentäter waren also nicht von einem unkontrollierbaren Hass bewegt, sondern auf einer abstrakt intellektuellen Ebene so von ihrer Sache überzeugt, dass sie den Tod Tausender Menschen allein um einer abstrakten Symbolik willen rechtfertigte und auch den eigenen Tod für die Sache in Kauf nehmen ließ. Eine solche Überzeugung setzt den Glauben an eine reine Wahrheit voraus: Eine Wahrheit, die rein ist von jedem Zweifel und deshalb jedes Gewissen rein waschen kann. Eine Wahrheit, die sich in einem völlig abstrakten Raum bewegt und deshalb gegenüber jedem Einfluss der Wirklichkeit immun ist. Eine Wahrheit, die in ihrer Reinheit religiösen Charakter hat – unabhängig davon, welche konkrete Religion sie zum Vorwand nimmt.
II.
Aber wie will man gegen einen solchen Terror vorgehen. Die normalen Mittel der Strafjustiz wirken nicht, weil die Täter sich gleich selbst mit umgebracht und dadurch der Strafverfolgung entzogen haben, während den Drahtziehern kaum etwas nachzuweisen ist, weil sie sich die Hände nicht schmutzig gemacht haben. Kein Wunder, dass jetzt viele von Vergeltung reden und selbst eine kühle NDR-Journalistin meint, das Neue Testament zur Seite legen zu müssen (wenn sie es denn je in der Hand gehabt hat), um Lev 24,19f. aufzuschlagen (wobei sie allerdings noch nicht einmal in der Lage ist, die Stelle richtig anzugeben). Aber kann man Terror mit Gegenterror beantworten? Oder wirft man dadurch nicht gleich die Werte über den Haufen, die man gegen den Terror verteidigen will? »Das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt …« (so das Leitwort in Heiner Müllers Stück »Mauser«)
Manche Berichterstatter bemerken auch, dass man eine Szenerie wie in Downtown Manhattan nach dem Einschlag der beiden Verkehrsflugzeuge in das World Trade Center sonst nur aus Katastrophen- und Actionfilmen kennt. In diesen Filmen dient die Ungeheuerlichkeit des Terrors dazu, die Aktionen des Helden von jedem ethischen Skrupel zu befreien: Er erhält die Lizenz zum Töten. Die Regisseure dieser Filme wissen, dass Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie viel zu kompliziert sind, um damit alle Mittel zu rechtfertigen. Aber durch die monströsen Dimensionen des Terrors, gegen den der Held kämpft, erhält man wenigstens ex negativo ein absolutes Ziel. Am deutlichsten wird das in den James-Bond-Filmen: Schon in den sechziger Jahren ist darin die Welt viel zu kompliziert, um nach dem Schema des Kalten Kriegs in Gut und Böse aufgeteilt zu werden. Die eigentliche Gefahr geht nicht von der Sowjetunion aus, sondern von einer international operierenden Terrororganisation, an deren Spitze ein Millionär steht, der ein Doppelleben führt. Aber nicht einmal James Bond erhält seine Lizenz zum Töten zum Zweck der Vergeltung, sondern allein um in letzter Sekunde (bzw. in den letzten zwanzig Minuten des Filmes) die globale Katastrophe zu verhindern.
Aber selbst wenn sich die Regierungen der »zivilisierten Welt«, die diese Terroranschläge als Kriegserklärung auffassen, nicht durch Vergeltungsmaßnahmen und Gegenterror auf die gleiche Stufe begeben, ist es fast unmöglich, sich von den Terroristen nicht das Gesetz des Handelns aufzwingen zu lassen. Schon allein deshalb, weil gegenüber einem solchen Terror alle anderen Themen zweitrangig werden, geht sehr viel an demokratischer Kultur verloren. Außerdem schränken die Sicherheitsmaßnahmen zwangsläufig auch die Bewegungsfreiheit eines jeden Bürgers ein. Darüber hinaus lehrt die Erfahrung, dass die Einschränkung demokratischer Kultur und bürgerlicher Freiheitsrechte sehr viel weiter geht. Schon gegenüber dem viel berechenbareren politischen Terror der siebziger Jahre wurden demokratische Grundrechte eingeschränkt. Alle, die eine grundsätzliche politische Kritik an der Regierung bzw. am Common Sense der politischen Parteien übten, mussten damit rechnen mit den Terroristen gleichgestellt zu werden. So müssen auch jetzt alle, die Kritik gegen die USA und die westlichen Wirtschaftsmächte erheben, damit rechnen, mit den Attentätern in eine Ecke gestellt zu werden. Die zaghafte Kritik an der Datei über linke »Gewalttäter« (in die auch Leute kommen, deren Personalien bei einer Anti-NPD-Demo festgestellt wurden) dürfte nun im Sand verlaufen. Auch die Stimmen derjenigen, die eine Verschärfung des Ausländerrechts und seiner Handhabung fordern, sind schon zu hören, obwohl doch jeder weiß, dass die Attentäter zu genau dem erlauchten Kreis von Ausländern gehören, den alle hereinlassen wollen: gebildet, an die europäische Kultur angepasst und politisch unauffällig – zumindest solange, wie sie als »Schläfer« in Deutschland auf ihren Einsatz warten.
Selbst wenn die NATO nicht mit einem reinen Vergeltungsangriff auf den Terror antwortet, besteht die Gefahr, dass die Maßnahmen, die gegen den Terror ergriffen werden, die Werte, die doch eigentlich verteidigt werden sollen, nach und nach aushöhlen. Auf der intellektuellen Ebene, bei der Frage, wie die Situation einzuschätzen ist, welche Maßnahmen ergriffen werden können und wie wir auf ideologischer Ebene auf den Terror und den möglichen Gegenterror (z. B. gegen Muslime in Deutschland) reagieren können, besteht das Problem darin, dass die Werte, die es zu verteidigen gilt, mit dem Konzept einer reinen Wahrheit nicht in Einklang zu bringen sind. Der reinen Wahrheit der Terroristen können wir nur eine »unreine Wahrheit« entgegenstellen: Eine Wahrheit die nicht auf eine schematische Unterscheidung von Gut und Böse aufbaut. Eine Wahrheit, die sich in Frage stellen lässt. Eine Wahrheit, die konkret ist und deshalb auch von der Wirklichkeit widerlegt werden kann.
In dem Stück von Heiner Müller, das ich oben zitiert habe, besteht die unreine Wahrheit darin, dass der Horatier für dieselbe Tat zuerst als Sieger gefeiert und dann als Schwagermörder hingerichtet wird. Die unreine Wahrheit ist so: Sie muss die widersprüchlichen Seiten der Wirklichkeit ins Auge fassen und eine Antwort finden, die nicht die eine Seite unter den Tisch kehrt.